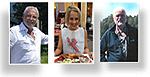Überall
daheim:
Die Kopczinski-Familien
Mein ![]() Vater, geboren
am 22.3.1903, hieß Johann (genannt 'Hans') Kopczinski. Meine Mutter,
Eva Kopczinski, ist eine geborene Rieck (über den Rieck-Clan finden
Sie alles auf diesen Seiten.) Der Vater
meines Vaters, also mein Großvater, war August Franz Kopczinski,
ein einfacher Landarbeiter, der am 23.7.1868 im damals polnischen Bobrowniki,
geboren wurde. Dessen Vater – mein Urgroßvater – schrieb
sich noch mit einem 'y' hinter dem 'cz', also Kopczynski...
mehr lesen...
Vater, geboren
am 22.3.1903, hieß Johann (genannt 'Hans') Kopczinski. Meine Mutter,
Eva Kopczinski, ist eine geborene Rieck (über den Rieck-Clan finden
Sie alles auf diesen Seiten.) Der Vater
meines Vaters, also mein Großvater, war August Franz Kopczinski,
ein einfacher Landarbeiter, der am 23.7.1868 im damals polnischen Bobrowniki,
geboren wurde. Dessen Vater – mein Urgroßvater – schrieb
sich noch mit einem 'y' hinter dem 'cz', also Kopczynski...
mehr lesen...
Die
KOPCZYNSKI's
in den USA

If your great grandpa Kopczynski
lived in Milwaukee, then we're
98% related!
(Wenn euer Ur-Opa Kopczynski
in Milwaukee lebte, dann
sind wir zu 98% verwandt.)
Check it!


Wo![]() sie lebten, wie sie lebten:
sie lebten, wie sie lebten:
![]() lebten
sie eigentlich, unsere Ur-Großväter, deren Geschwister, Frauen
und Kinder, vor mehr als 150 Jahren? Wo genau kommen sie her, all die
Clans, die zu jedem Stammbaum gehören? Unsere Kopczinski's, Riecks,
Kopczynski's mit 'y', die Igiels, Werners, Ziegenhagens, Semraus und all
die anderen aus unserer Ahnentafel? Wie lebten sie in Schlochau, Stegers,
Hammerstein oder Bobrowniki...?
lebten
sie eigentlich, unsere Ur-Großväter, deren Geschwister, Frauen
und Kinder, vor mehr als 150 Jahren? Wo genau kommen sie her, all die
Clans, die zu jedem Stammbaum gehören? Unsere Kopczinski's, Riecks,
Kopczynski's mit 'y', die Igiels, Werners, Ziegenhagens, Semraus und all
die anderen aus unserer Ahnentafel? Wie lebten sie in Schlochau, Stegers,
Hammerstein oder Bobrowniki...?
Unsere Rieck-Ahnen kommen praktisch fast alle aus der einst deutschsprachigen,
nördlichen Region Polens, zwischen dem 17. und 18. Längengrad.
Das ist heute das westliche Polen, das an den Osten von Deutschland grenzt
(vor mehr als 100 Jahren als 'Westpreußen' bekannt). Die nächste
wirkliche Großstadt war Danzig im Nordosten. Die kleineren Kreisstädte
der Bezirksverwaltungen für unsere Rieck-Vorfahren waren damals Schlochau,
Konitz und Flatow (Karte
mit den Heimatorten der Riecks ansehen). Aus dieser Region stammen
naturgemäß auch die weiblichen Vorfahren, die einen Rieck-Mann
heirateten und dann dessen Familiennamen annahmen. Die Mädchennamen
unserer Ur-Großmütter lauteten, Semrau, Ziegenhagen, Werner,
Bleck, Michal(ski), Albrecht, Panknien und Becker.
Die frühe preußisch deutschsprachige Heimat der Kopczynski's
und ihrer angeheirateten Damen lag hingegen in Süd-Polen (damals
Posen) auf der Längengrad-Linie von Danzig. Sie lebten in und um
die kleineren Ortschaften Bobrowniki und Kattowitz. Die
mir bekannten weiblichen Vorfahren und Ur-Großmütter trugen
Familiennamen wie Igiel bzw. Idel, Katowska, Pazcka,
Holsbeck, Rosewicz und Dziabas.
Wie gesagt, dies war die Heimat unserer mehrfachen Ur-Ahnen etwa von 1740
bis 1895 (weiter zurück konnten wir leider nicht recherchieren).
Später zogen zahlreiche Nachfahren (unsere Großväter und
Großmütter) westwärts, um sich unter anderem in Berlin,
Hamburg und im Frankfurter Raum niederzulassen...
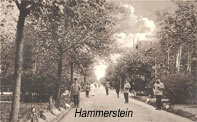
Der kleine Ort Hammerstein (heute Czarne) im Kreis Schlochau (Westpreußen)
ist die älteste uns bekannte Heimat der Familie Rieck. Im Jahr 1770
lebten dort rund 660 Dorfbewohner; zwei Drittel von ihnen waren Katholiken,
knapp ein Drittel war evangelisch. Etwa ein Dutzend Juden gehörten
ebenfalls zu der kleinen Ortschaft. Um 1850 lebten in Hammerstein etwa
1.800 Personen – unter ihnen die beiden Rittergutsbesitzer August
Kummer (1790–1876) und George
von Livonius (1792–1867). 1943 wurde der Sänger und Gitarrist der
Beat- und Rockband 'The Lords', Klaus-Peter
Lietz, in Hammerstein geboren. Die uns bekannten ältesten dort
lebenden Familien waren die Riecks (1753), Albrechts (1793), die Familien
Bohn (1815), Buchholz (1820), Daunert (1764), Heller und Hellwig (1806),
Jacoby (1835), Mausolf (1811), Ruskowius (1780) und Waldow (1739).
Für eine etwa 30 Kilometer weite Kutschfahrt von Hammerstein zum
Markt oder zur Kreisbehörde nach Schlochau musste damals ein ganzer
Tag eingeplant werden. Oft übernachtete man unterwegs bei Verwandten
und kehrte erst am nächsten Tag wieder nach Hause zurück. Solche
'Einkaufsfahrten' über die schlechten Wege und Landstraßen
waren aber eher selten. In den klirrend kalten Wintermonaten wurde darauf
– wenn möglich – ganz verzichtet. Zu strapaziös war
die Fahrt für Mensch und Tier.

Nur wenige Kilometer nördlich von Hammerstein gab es den kleinen
Ort und Pfarrsitz Stegers (heute = Rzeczenica, Polen). Bereits
im Jahre 1690 entstand hier eine Schule. Adam Klemp und sein Sohn Peter
Klemp unterrichteten jahrzehntelang die Kinder des Ortes in ihrem Haus.
Bis 1865 betrieb man in Stegers eine (mäßig erfolgreiche) Bernsteingräberei,
und im frühen 20. Jahrhundert siedelten sich dort ein Sägewerk, eine
Zementfabrik, eine Molkerei und eine Mühle an. Selbst im späten Jahr
1930 gab es dort nur 280 Wohngebäude in sieben kleinen Siedlungen.
In dieser Zeit hatte ein Rieck-Sprössling ein Hotel in Stegers. Etwa
80 Jahre davor lebten nur sehr wenige Familien dort und doch heirateten
viele junge Frauen aus Stegers und der nahen Umgebung einen Rieck-Mann,
der das kleine Nachbardorf zum Werben um seine Liebste aufsuchte...
Zu den 'alteingesessenen' traditionellen Familien in Stegers gehörten
die Semraus (seit 1772 nachweisbar), die Werners (1750), Ziegenhagens
(1750) sowie die Familien Wenzel (1820), Rieck (1750), Weber (1750), Albrecht
(1752), Becker (1750), Spors (1725) und Strey (1740). Mein Vorfahre, Ur-Großvater
Rieck, arbeitete hier – wie schon sein Vater – als Schuhmacher.
Der Ur-Großvater mütterlicherseits, Johann Albert aus der Familie
Werner, war Landbriefträger in Stegers.
Auch das nahe gelegene Dorf Bärenwalde (=Bincze, Polen)
taucht zuweilen in den Familiengeschichten der Riecks auf...

Etwa 100 Kilometer südlich von Hammerstein und Stegers streiften
– um ihre Liebsten zu finden – die jungen Männer der Kopczynski's
und Kopczinski's durch die Wälder von Bobrowniki, Jankendorf, Potulice
und Siebenschlösschen. Wie im 100 km entfernten Hammerstein hatten
die Kopczinskis meist einen Kutschwagen oder Einspänner und einen kleinen
Kastenwagen für die Tagesarbeiten. Für die Winterzeit gab es fast
immer einen grossen Schlitten, worauf bis zu fünf Personen sitzen
konnten. Im Sommer gab es in den umliegenden kleinen Dörfern mindestens
ein Gemeindefest pro Jahr. Mit den Mädchen wurden für dieses Ereignis
stets schöne Volkstänze und Theaterspiele eingeübt.
Man kannte zur Beleuchtung nur Petroleumlampen, Talglichter, oder Laternen.
Elektrisches Licht gab es nur in größeren Städten. Geheizt
wurde mit Holz oder Torf, welcher im Sommer in ziegelsteingrossen Stücken
auf den Wiesen gestochen und getrocknet wurde. Im Winter befeuerte man
dann damit die Küchenherde oder Kachelöfen, die eine gemütliche
Wärme ausströmten. Im Winter gab es sonntags zum Frühstück manchmal
ausgelassenen Speck. In das Fett tunkte man das Brot und aß dazu den krossen
Speck. 'Normale' Frühstücke bestanden meist aus Milchsuppe von Gerstengrütze.
Wer wollte, brockte sich Brot ein und kippte etwas Zucker darauf. Wenn
die Schweine fett genug waren, wurden sie entweder von den Männern
der Familie geschlachtet, oder es kam ein Schlachter, der die Tiere aufkaufte.
Die Kinder bekamen dann von ihm für jedes verkaufte Schwein ein sogenanntes
'Schwanzgeld', was unter ihnen große Euphorie auslöste.
Die angeheirateten, späteren Kopczynski-Damen kamen aus den Familien
Idel (Igiel), Kotowska (Katowska), Holsbeck, Paczka, Dziabas und Rozewicz.
Die männlichen Vorfahren der Kopczynski's waren meist einfache Handwerker
oder Landarbeiter. Mein Großvater, Franz Kopczinski (Kopczynski),
heiratete am 8. Januar 1893 im Alter von 23 Jahren die 19jährige
Marianna Igiel aus Siebenschlößchen. Mit ihr zog er als junger
Tagelöhner nach Westen und fand eine neue Heimat auf einem Gutshof
der Familie Nahmacher im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, nahe Teterow
bei Rostock. Es gab dort eine neue Wassermühle, ein Landarbeiterhaus
und ab 1899 ein neues Anwesen (Gutshaus) für die Nahmacher's.